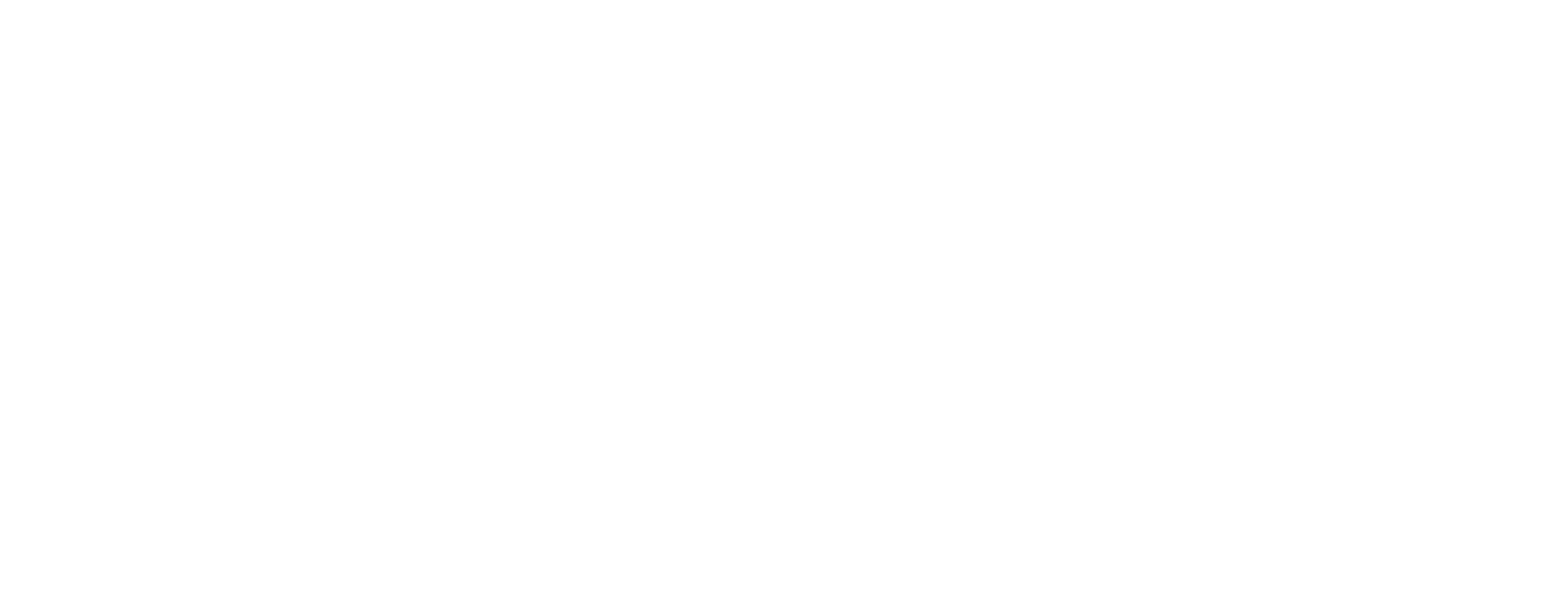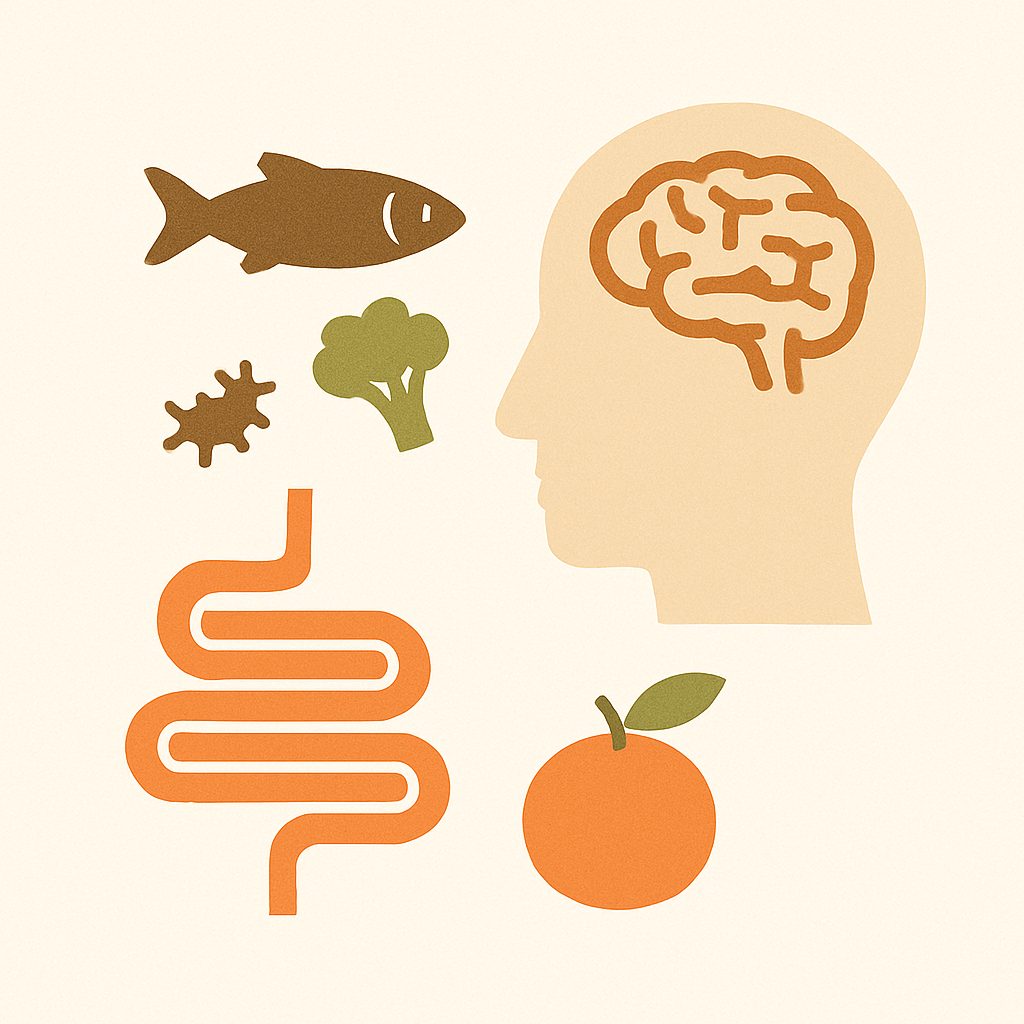Antibiotika haben seit ihrer Entdeckung unzählige Leben gerettet – gleichzeitig beeinflussen sie aber auch massiv das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora. Während sie Krankheitserreger bekämpfen, zerstören sie häufig auch nützliche Bakterien. Dies kann kurzfristige Beschwerden wie Durchfall und langfristige Dysbiosen zur Folge haben, die das Immunsystem schwächen und chronische Erkrankungen begünstigen (Francino, 2016).
Antibiotika wirken nicht selektiv. Sie greifen sowohl pathogene als auch nützliche Mikroorganismen an. Dadurch wird die mikrobielle Vielfalt drastisch reduziert, das Verhältnis zwischen nützlichen und schädlichen Bakterien verschiebt sich und die Regeneration des Mikrobioms kann sich über Wochen bis Monate verzögern (Palleja et al., 2018). Besonders betroffen sind dabei Bifidobakterien, Lactobacillen und butyrat-produzierende Bakterien wie Faecalibacterium prausnitzii.
Die Folgen reichen von kurzfristigem antibiotika-assoziierten Durchfall (AAD) bis hin zu einer erhöhten Anfälligkeit für resistente Keime wie Clostridioides difficile. Auch langfristig kann eine gestörte Darmflora das Risiko für Allergien, das metabolische Syndrom und entzündliche Darmerkrankungen erhöhen (Langdon et al., 2016).
Ein bewusster Umgang mit Antibiotika ist daher essenziell. Sie sollten nur bei medizinischer Notwendigkeit eingesetzt und möglichst zielgerichtet ausgewählt werden. Ergänzend kann eine probiotische Unterstützung helfen: Bestimmte Stämme wie Saccharomyces boulardii und Lactobacillus rhamnosus GG konnten in Studien das Risiko für antibiotika-assoziierte Durchfälle deutlich senken (Hempel et al., 2012).
Produkte wie puragut, die gezielt ausgewählte Bakterienstämme enthalten, können die Regeneration des Mikrobioms nach einer Antibiotikatherapie fördern und helfen, die Darmbarriere zu stabilisieren. Eine ballaststoffreiche Ernährung unterstützt diesen Prozess zusätzlich. Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Haferflocken sowie fermentierte Produkte wie Sauerkraut und Joghurt liefern Nährstoffe, die nützliche Bakterien beim Wiederaufbau stärken. Polyphenolreiche Pflanzenstoffe aus Beeren oder grünem Tee können ebenfalls zur Regeneration beitragen.
Wichtig ist auch die richtige zeitliche Abstimmung: Probiotika sollten nicht gleichzeitig mit Antibiotika eingenommen werden, sondern mit einem Abstand von mindestens zwei bis drei Stunden.
Antibiotika bleiben unverzichtbare Medikamente. Doch wer sie bewusst einsetzt und die Darmflora gezielt unterstützt, kann das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen deutlich verringern und langfristig seine Darmgesundheit erhalten.
Rechtlicher Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Bei Beschwerden oder gesundheitlichen Fragen sollte stets eine medizinische Fachperson konsultiert werden. Für eventuelle Nachteile, die aus der Selbstanwendung der hier gegebenen Informationen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Quellen
Francino, M. P. (2016). Antibiotics and the Human Gut Microbiome: Dysbioses and Accumulation of Resistances. Frontiers in Microbiology, 6, 1543.
Palleja, A., et al. (2018). Recovery of gut microbiota of healthy adults following antibiotic exposure. Nature Microbiology, 3(11), 1255–1265.
Hempel, S., et al. (2012). Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 307(18), 1959–1969.
Langdon, A., et al. (2016). The effects of antibiotics on the microbiome throughout development and alternative approaches for therapeutic modulation. Genome Medicine, 8(1), 39.
Becattini, S., Taur, Y., & Pamer, E. G. (2016). Antibiotic-induced changes in the intestinal microbiota and disease. Trends in Molecular Medicine, 22(6), 458–478.
Dethlefsen, L., et al. (2008). The pervasive effects of an antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S rRNA sequencing. PLoS Biology, 6(11), e280.