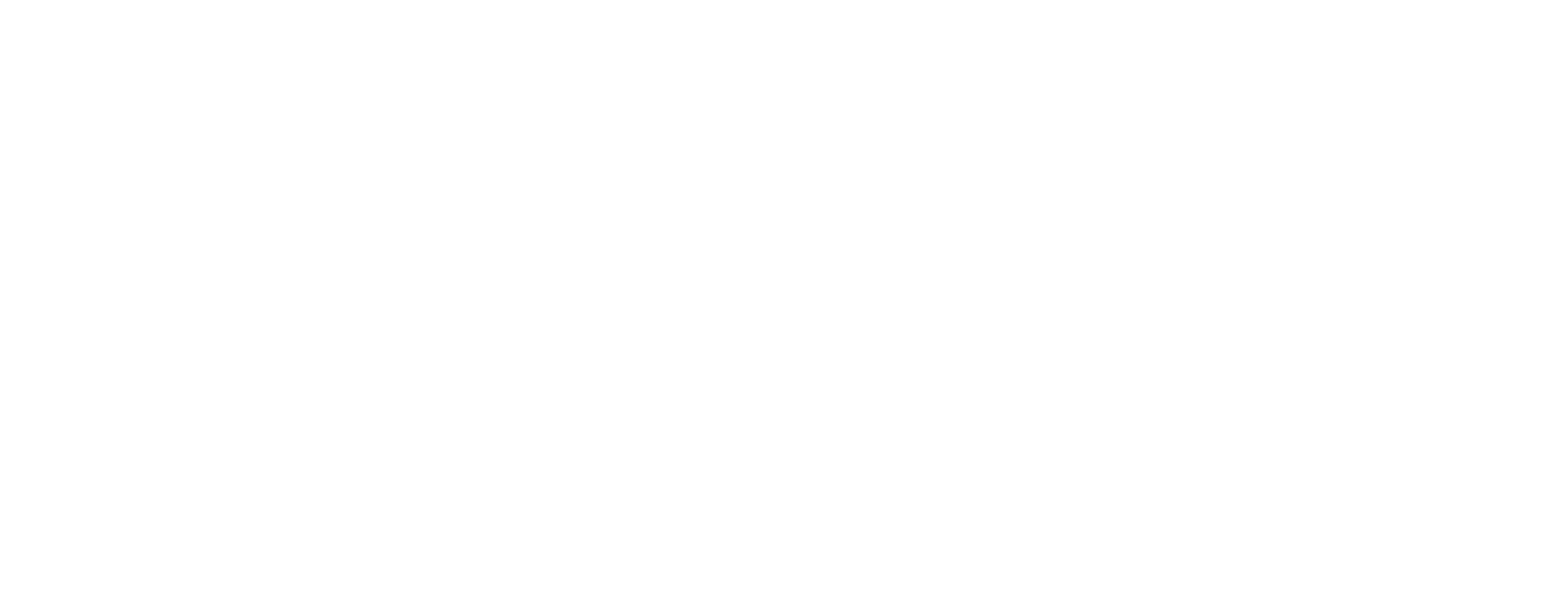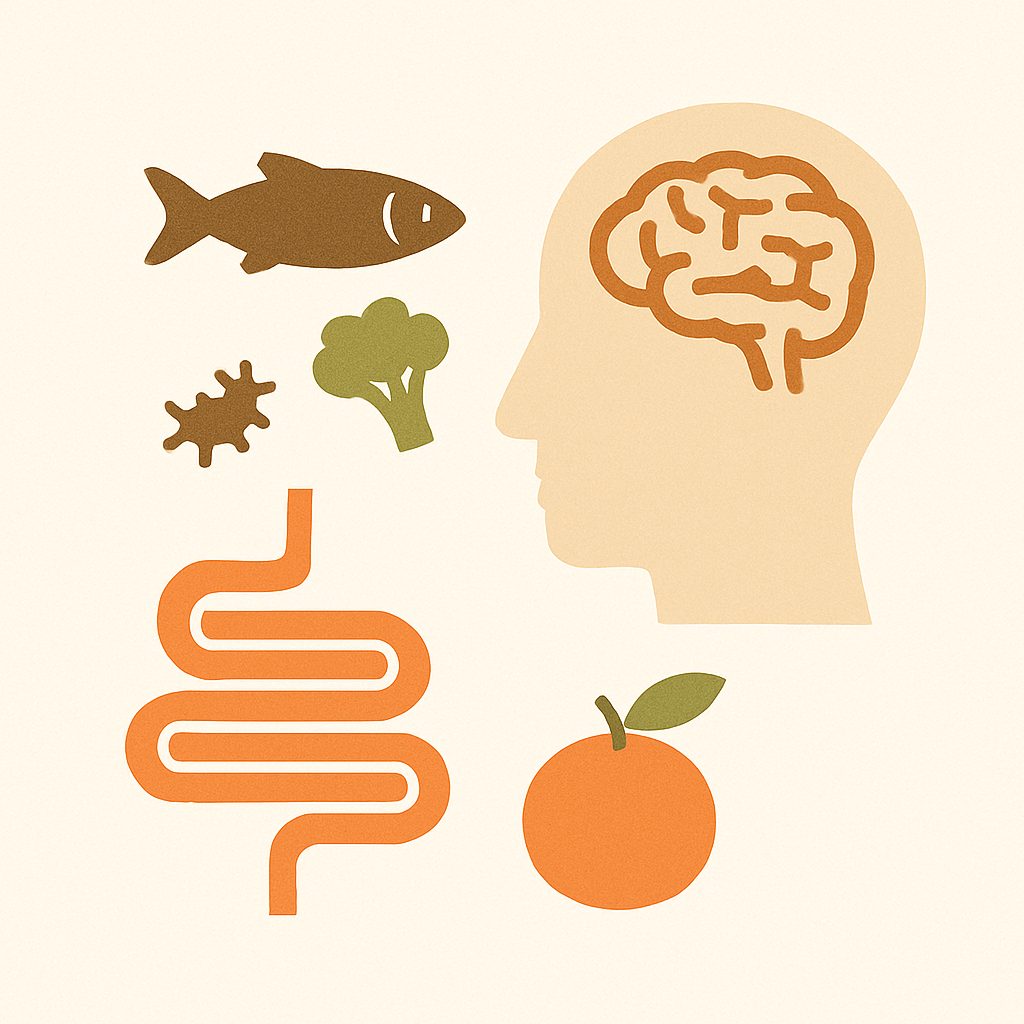Unser Darm beherbergt ein komplexes Ökosystem aus Billionen Mikroorganismen – das sogenannte Mikrobiom. Es übernimmt zentrale Aufgaben bei der Verdauung, der Regulation des Immunsystems und der Produktion von Neurotransmittern. Gerät dieses sensible Gleichgewicht aus der Balance, spricht man von einer Dysbiose. Studien zeigen, dass Dysbiosen mit zahlreichen Beschwerden in Zusammenhang stehen, von Reizdarm über Hautprobleme bis hin zu depressiven Verstimmungen (Petersen et al., 2019; Qin et al., 2010).
Bei einer Dysbiose ist das Gleichgewicht der Bakterien im Darm gestört. Die Zahl nützlicher Bakterien kann verringert sein, während sich pathogene oder entzündungsfördernde Keime ausbreiten. Auch eine verringerte Diversität – also eine geringere Vielfalt an Arten – ist typisch. Das verändert das gesamte Darmmilieu, beeinträchtigt die Schleimhautbarriere und die Nährstoffverwertung (Lozupone et al., 2012).
Viele Betroffene berichten über diffuse Beschwerden wie Blähungen, unregelmäßigen Stuhl, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder chronische Erschöpfung. Auch Hautprobleme, häufige Infekte oder eine erhöhte Allergieneigung können durch eine veränderte bakterielle Besiedlung begünstigt werden (Tilg & Kaser, 2011).
Die Ursachen für Dysbiosen sind vielfältig: Antibiotika, ballaststoffarme Ernährung, chronischer Stress oder eine frühkindliche Keimarmut gelten als Hauptfaktoren. Auch Magensäureblocker, künstliche Süßstoffe oder Konservierungsmittel können das Mikrobiom nachweislich stören (Imhann et al., 2016; Suez et al., 2014).
Eine fundierte Mikrobiomanalyse aus dem Stuhl liefert die aussagekräftigsten Hinweise auf eine Dysbiose. Besonders auffällig ist eine reduzierte Anzahl nützlicher Bakterienstämme wie Bifidobacterium oder Faecalibacterium prausnitzii (Miquel et al., 2013). Auch Entzündungsparameter wie Calprotectin oder Marker für Schleimhautdurchlässigkeit wie Zonulin (Fasano, 2012) können Hinweise auf Störungen geben.
Die Therapie einer Dysbiose zielt darauf ab, die mikrobielle Vielfalt wiederherzustellen. Eine pflanzenreiche, ballaststoffbetonte Ernährung liefert wichtige Substrate für nützliche Bakterien. Besonders geeignet sind fermentierbare Ballaststoffe wie resistente Stärke oder Akazienfaser (Slavin, 2013). Probiotika mit Stämmen wie Lactobacillus rhamnosus GG oder Bifidobacterium breve können zusätzlich entzündliche Prozesse modulieren (Ouwehand et al., 2002; Hemarajata & Versalovic, 2013).
Präparate wie puragut bieten eine stabile Kombination bewährter Stämme und sind besonders für sensible Verdauungssysteme geeignet. Ergänzend können L-Glutamin, Aloe Vera oder Omega-3-Fettsäuren die Schleimhautregeneration fördern (Hoffmann et al., 2013). Auch Stressmanagement spielt eine zentrale Rolle, denn Stress kann die Darmflora nachhaltig verändern (Bailey et al., 2011).
Fazit:
Eine Dysbiose betrifft nicht nur den Darm – sie kann das gesamte körperliche und psychische Wohlbefinden beeinflussen. Wer unter chronischen Beschwerden leidet, sollte das Mikrobiom im Blick haben und gezielt Maßnahmen ergreifen, um das Gleichgewicht im Darm wiederherzustellen.
Rechtlicher Hinweis:
Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei anhaltenden Beschwerden sollte eine ärztlich oder mikrobiologisch geschulte Fachperson konsultiert werden.
Quellen
Petersen, C., & Round, J. L. (2019). Defining dysbiosis and its influence on host immunity and disease. Cell Microbiology, 21(4), e13044.
Qin, J., et al. (2010). A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. Nature, 464(7285), 59–65.
Lozupone, C. A., et al. (2012). Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. Nature, 489(7415), 220–230.
Tilg, H., & Kaser, A. (2011). Gut microbiome, obesity, and metabolic dysfunction. Journal of Clinical Investigation, 121(6), 2126–2132.
Imhann, F., et al. (2016). Proton pump inhibitors affect the gut microbiome. Gut, 65(5), 740–748.
Suez, J., et al. (2014). Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature, 514(7521), 181–186.
Miquel, S., et al. (2013). Faecalibacterium prausnitzii and human intestinal health. Current Opinion in Microbiology, 16(3), 255–261.
Fasano, A. (2012). Zonulin and its regulation of intestinal barrier function. Physiological Reviews, 91(1), 151–175.
Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 1417–1435.
Ouwehand, A. C., et al. (2002). Probiotic and other functional microbes: from markets to mechanisms. Current Opinion in Biotechnology, 13(5), 483–487.
Hemarajata, P., & Versalovic, J. (2013). Effects of probiotics on the microbiome and mechanisms of action. Gastroenterology Clinics, 42(4), 971–984.
Bailey, M. T., et al. (2011). Exposure to a social stressor alters the structure of the intestinal microbiota. Brain, Behavior, and Immunity, 25(3), 397–407.
Hoffmann, D. E., et al. (2013). Nutritional modulation of intestinal microbiota: future opportunities. Nutrition Reviews, 71(9), 605–623.