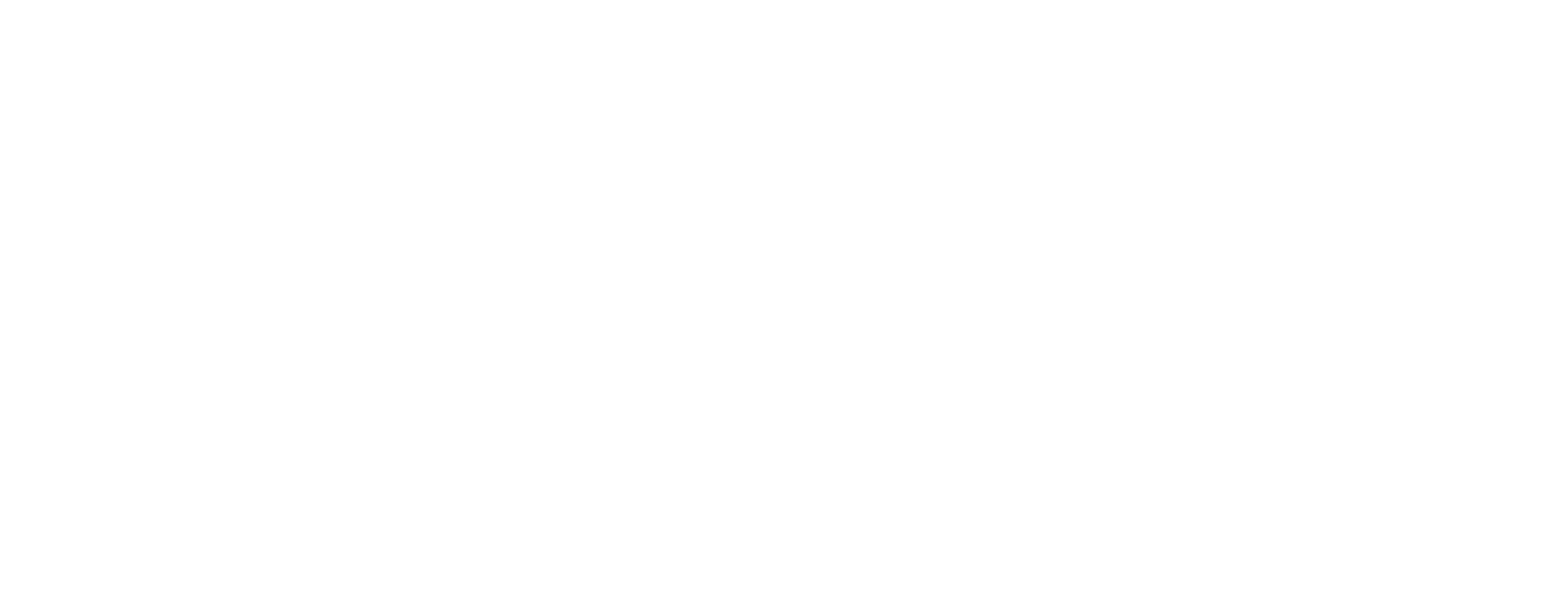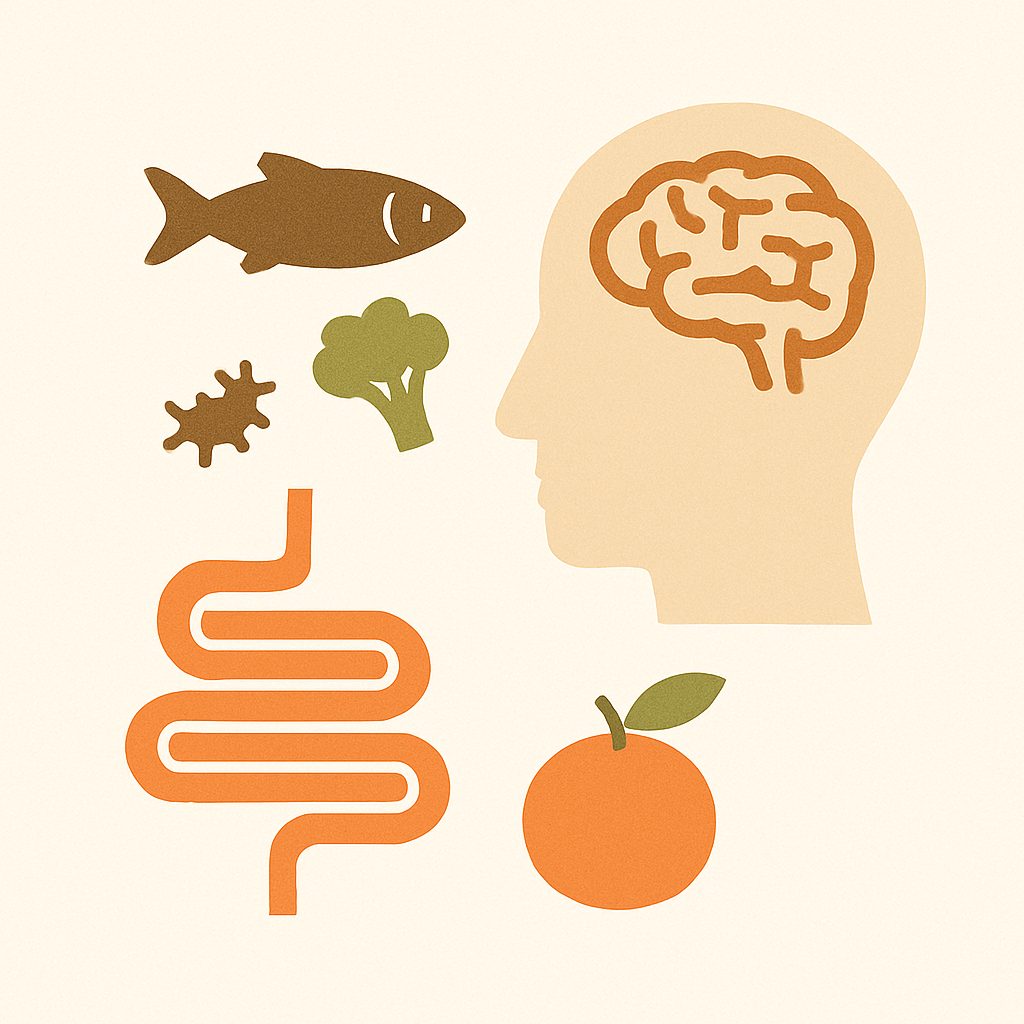Reisen erweitert den Horizont – kann aber auch die Darmflora durcheinanderbringen. Ob durch Zeitumstellungen, fremde Ernährung, veränderte Hygienebedingungen oder Stress: Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms reagiert empfindlich auf Ortswechsel. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bereits kurze Reisen die bakterielle Vielfalt im Darm messbar beeinflussen können (David et al., 2014).
Veränderte Essgewohnheiten, neue Lebensmittel, hohe Fett- oder Zuckeranteile und weniger Ballaststoffe können die Mikrobiota belasten (Sonnenburg & Sonnenburg, 2019). Stress durch Flugreisen, Jetlag oder ungewohnte Tagesrhythmen wirkt sich über die Darm-Hirn-Achse negativ auf die Verdauung aus (Moloney et al., 2016). Der Kontakt mit neuen Umweltkeimen verändert das Mikrobiom – im positiven wie negativen Sinne (Zuo & Ng, 2018). In bestimmten Regionen kann kontaminiertes Trinkwasser zusätzlich das Risiko für Infektionen und Dysbiose erhöhen.
Häufige Beschwerden auf Reisen sind Reisedurchfall, Blähungen, Völlegefühl, Verstopfung oder Übelkeit. Studien belegen, dass probiotische Präparate wie Saccharomyces boulardii oder Lactobacillus rhamnosus GG helfen können, das Risiko für Reisedurchfall zu senken (McFarland, 2007). Auch puragut eignet sich durch seine stabile Zusammensetzung zur begleitenden Unterstützung.
Neben der Probiotikazufuhr empfiehlt sich die Mitnahme ballaststoffreicher und fermentierter Lebensmittel wie Trockenfrüchte oder Sauerkraut. Nur abgekochtes oder abgefülltes Wasser sollte getrunken werden. Regelmäßige Bewegung fördert die Darmtätigkeit und reduziert Stress.
Fazit: Reisen verändert nicht nur unsere Umgebung, sondern auch unsere Darmflora. Wer seine Verdauung unterwegs gezielt unterstützt, kann Dysbalancen vorbeugen. Probiotische Begleiter wie puragut sowie eine ballaststoffreiche, hygienebewusste Ernährung helfen, das Mikrobiom im Gleichgewicht zu halten.
Rechtlicher Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Bei Beschwerden oder gesundheitlichen Fragen sollte stets eine medizinische Fachperson konsultiert werden.
Quellen
David, L. A., et al. (2014). Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature, 505(7484), 559–563.
McFarland, L. V. (2007). Meta-analysis of probiotics for the prevention of traveler's diarrhea. Travel Medicine and Infectious Disease, 5(2), 97–105.
Moloney, R. D., et al. (2016). The microbiome: stress, health and disease. Mammalian Genome, 27(7-8), 377–387.
Sonnenburg, J. L., & Sonnenburg, E. D. (2019). Starving our microbial self: The deleterious consequences of a diet deficient in microbiota-accessible carbohydrates. Cell Metabolism, 20(5), 779–786.
Zuo, T., & Ng, S. C. (2018). The impact of microbiota on the pathogenesis of IBD. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 15(10), 634–647.
Whelan, K., & Myers, C. E. (2010). Safety of probiotics in patients receiving nutritional support: a systematic review of case reports, randomized controlled trials, and nonrandomized trials. American Journal of Clinical Nutrition, 91(3), 687–703.